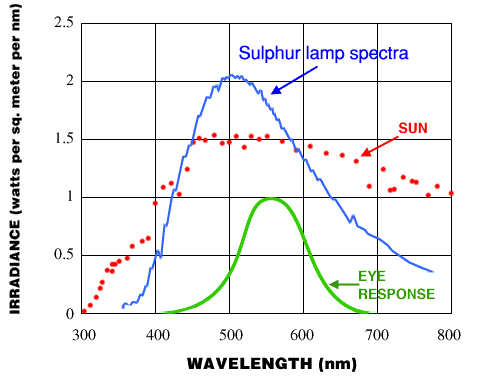Autor:
Ahmet Cakir
Kurzfassung
Die Idee des „Vollspektrumlicht“ wurde geboren als Reaktion auf ungleichmäßige Spektren von Leuchtstofflampen. Dahinter steckt die Vorstellung, dass man Tageslicht mehr oder weniger gut künstlich nachbilden könnte. „Vollspektrumlicht“ soll vielfältige positive Effekte auf das Befinden und die Gesundheit des Menschen entfalten und so das Leben in der Arbeitswelt in Räumlichkeiten mit wenig oder ohne natürliches Licht verbessern.
Obwohl eine umfangreiche Literatur zum Thema existiert, sind die behaupteten Wirkungen heftig umstritten, wozu sicherlich beiträgt, dass die meisten veröffentlichten „Studien“ einer halbwegs strengen methodischen Prüfung nicht standhalten können. Man muss aber berücksichtigen, dass viele der vorgebrachten Gegenargumente nicht besser begründet sind. Seit dem Februar 2001 liegt eine begutachtete Literaturstudie der Autorinnen Veitch, J. A.; McColl, S. L. zu diesem Thema vor, die sich bereits früher mit dem Vollspektrumlicht auseinander gesetzt hatten. Anhand dieser Publikation kann man eine umfassende Diskussion des Themas „Vollspektrumlicht“ durchführen.
Bei der Bewertung der Argumentation sollte berücksichtigt werden, dass der Begriff „Vollspektrumlicht“ sowohl für das Licht der so bezeichneten Lampen als auch für eine Beleuchtung mit solchen Lampen benutzt wird. Die Unterscheidung ist deswegen besonders wichtig, weil viele Erkenntnisse über die gesundheitliche Wirkung durch Versuche gewonnen worden sind, bei denen „Vollspektrumlampen“ zu Therapiezwecken eingesetzt worden sind.
In Veröffentlichungen werden u.a. folgende Wirkungen angeführt:
* Vollspektrumlicht soll das Sehvermögen dramatisch steigern, das Lernverhalten von Schülern und den Lernerfolg verbessern.
* Der UV-Anteil der emittierten Strahlung soll in Arbeitsstätten die Wirkung ersetzen, die das Tageslicht im Freien ausüben würde. Hierzu ist zu bedenken, dass der Mensch in Industriegesellschaften bis zu 90% seines Lebens in geschlossenen Räumen verbringt, in die Tageslicht nicht, wenig oder spektral verändert eintritt.
* Vollspektrumlampen sollen bei der Therapie von Winterdepression erfolgreich sein.
* Vollspektrumlampen sollen sich positiv bei Hyperaktivitätsstörungen von Kindern auswirken.
Insgesamt werden ausschließlich positive Wirkungen behauptet, die von einer Verbesserung der Befindlichkeit bis hin zur Verhütung von Krebserkrankungen reichen.
Die behaupteten Wirkungen von Vollspektrumlicht konnten häufig nicht nachgewiesen werden. Die von Veitch und McColl geprüften Studien wiesen allerdings viele methodische Mängel auf, so dass man nicht den Schluss ziehen darf, dass die Wirkungen nicht vorhanden seien. Vielfach waren die Studien nicht geeignet, um bestimmte Effekte nachzuweisen.
Unabhängig von der tatsächlich vorhandenen Wirkung hat die Idee des Vollspektrumlichts einen durchschlagenden Effekt in der Anregung zur Erforschung des Einflusses von Licht auf den Menschen erzielt. Die medizinische Forschung hat hierbei u.a. das Licht bzw. eher den Mangel an Licht als die Ursache der seit mehr als 2.000 Jahren bekannten Winterdepression entlarvt.
Beitrag
Anlass
Die Studien, die vom ERGONOMIC Institut zum Thema „Licht und Gesundheit“ durchgeführt und seit dem Jahr 1990 in dem gleichnamigen Forschungsbericht veröffentlicht wurden, haben das sog. „Vollspektrumlicht“ stets unberücksichtigt gelassen. Der Grund für uns war die mangelnde Installationsbasis in der Praxis, die eine groß angelegte Feldstudie nicht zuließ. Mit kleineren Feldstudien, an denen nur wenige Testpersonen teilgenommen haben, hat man zwar den größten Teil des Wissens in der Lichttechnik ermittelt, jedoch würden nur wenige empirische Arbeiten auf diesem Gebiet auch nur halbwegs strengen Anforderungen an wissenschaftliche Methodik erfüllen. Die Literatur um eine neue Publikation zu erweitern, die mit Mängeln behaftet wäre, die der Autor an anderer Stelle kritisiert, verbietet sich von selbst.
Seit dem Februar 2001 liegt nunmehr eine Literaturstudie der Autorinnen Veitch, J. A.; McColl, S. L. zu diesem Thema vor, die sich bereits früher mit dem Vollspektrumlicht auseinander gesetzt hatten. Da die Veröffentlichung begutachtet ist, kann man davon ausgehen, dass sie methodisch überprüft ist, was naturgemäß nicht notwendigerweise für die darin kommentierte Literatur gilt. Veitch hat beim 101. Jahreskongress der American Psychological Association ein Symposium zu diesem Thema veranstaltet, dessen Einzelbeiträge auch vorliegen und von hier abgerufen werden können. Es existiert daher eine hinreichende Basis an Literatur, die kommentiert werden kann.
Was ist „Vollspektrumlicht“
Auf diese Frage lässt sich eine einfache und eine erklärende Antwort finden. Die einfache Antwort ist: „Vollspektrumlicht“ ist Tageslicht bzw. dessen Simulation mit elektrisch erzeugtem Licht. Diese Antwort kann aber nicht befriedigend sein, da man bei der Suche nach dem Spektrum des Tageslichts nicht nur ein Spektrum finden wird.
Erklären kann man das Wort „Vollspektrumlicht“ ausgehend vom Spektrum einer Entladungslampe (s. Bild 1).
Bild 1 Spektrum einer Entladungslampe (Quelle http://www.cwaller.de)
Dieses Spektrum ist geprägt durch Licht mit ausgesprochen ungleichmäßiger Verteilung mit einem übermäßig großen Anteil im grünen bzw. gelben Bereich. Als „Voll“ bezeichnet man das Spektrum, wenn es etwa der (gleichmäßigen) Verteilung des Sonnenlichts entspricht, das aus Bild 2 hervorgeht.
Bild 2 Verteilung des Spektrums des Sonnenlichts und einer Schwefellampe (Quelle: http://international.mmm.com)
Diese Kurven zeigen, dass das Sonnenlicht (nicht zu verwechseln mit Tageslicht) ein kontinuierliches Spektrum aufweist, das zwar im Bereich der höchsten Augenempfindlichkeit etwa den Höchstwert hat, aber nicht nur dort. Ein erheblicher Teil der Sonnenstrahlung wird bei kleineren Wellenlängen (< 380 nm) emittiert als Licht, das ist die lebenswichtige UV-Strahlung. (Anm.: Die vielfach benutzte Bezeichnung „UV-Licht“ entspricht nicht der lichttechnischen Nomenklatur.)
Was in der Praxis als „Vollspektrumlampe“ bezeichnet wird, emittiert zum einen ein wesentlich „volleres“ Spektrum als in Bild 1 und zum anderen einen Anteil an UV-Strahlung. Allerdings ist die Näherung an die Spektralverteilung des Sonnenlichts alles andere als ideal (Bild 3). Häufig werden die Emissionsspitzen zur Verschönerung des Bildes gekappt, wodurch man eine nicht vorhandene Gleichmäßigkeit vortäuscht.
Die „Vollspektrumlampen“ zeichnen sich dadurch aus, dass ihre ähnlichste Farbtemperatur oberhalb 5.000 K liegt und ihre Farbwiedergabe den meisten Leuchtstofflampen überlegen ist (allgemeiner Farbwiedergabeindex >90). Damit wirkt ihr Licht „kälter“ als bei Lampen der Lichtfarben „warmweiß“ und „neutral weiß“.
Bild 3 Spektrum einer Vollspektrumlampe (Quelle: Boyce, 1994)
Eine Auseinandersetzung mit der „Vollspektrumlampe“ und ihren Eigenschaften findet sich in Boyce, 1994.
Die Anhebung der spektralen Anteile des Lichts einer Lampe hat in der Regel einen gravierenden Einfluss auf deren Lichtausbeute. Bei zwei Lichtquellen mit ähnlicher Technik der Lichterzeugung (z.B. Leuchtstofflampen) weist diejenige, die ein gleichmäßiges Spektrum emittiert, immer eine kleinere Lichtausbeute auf als diejenige, die vorwiegend im gelb-grünen Bereich emittiert. Dieser Unterschied ist nicht etwa marginal, vielmehr verbrauchen „DeLuxe“-Lampen (Bild 4) mit besserem Spektrum für die Erzeugung des gleichen Lichtstroms bis zu 60% mehr Energie als vergleichbare Lampen mit schlechterem Spektrum. Für einen Bauherrn heißt dies, dass man bei einem gewissen Beleuchtungsniveau etwa 2/3 mehr an Lampen bzw. Leuchten installieren muss.
Bild 4 Vergleich der Spektren einer DeLuxe-Lampe und einer relativ billigen Entladungslampe
(Quelle der Bilder: http://www.cwaller.de)
Ist Vollspektrumlicht gleich Vollspektrumbeleuchtung?
Das Licht einer Lampe bestimmt zwar die Qualität des Lichts in einem Raum mit, jedoch nicht immer und nicht unbedingt erheblich. So bestimmen die Raumbegrenzungsflächen und die Möblierung das Farbklima zuweilen stärker als die benutzte Lichtquelle. Auch die Eigenschaften der Leuchte verändern die Spektralverteilung des erzeugten Lichts nicht unerheblich. Genau genommen lebt die Wohnraumbeleuchtung davon, die Farbe des Lichts mehr oder weniger stark mit Lüstern, Lampenschirmen u.ä. zu verändern und damit Stimmungen zu erzeugen.
Vollspektrumlicht und Vollspektrumbeleuchtung können dann etwa gleich gesetzt werden, wenn es sich um Tageslichtbeleuchtung handelt oder wenn bei Direktbeleuchtung weitgehend farbneutrale Raumbegrenzungsflächen vorhanden sind. Ansonsten muss bei einer Studie stets beachtet werden, ob der Gegenstand Licht oder Beleuchtung war. Beispielsweise hat beim Symposium der American Psychological Association der Fürsprecher für Vollspektrumlicht über Lichttherapieboxen berichtet, die man für die Behandlung von saisonaler Depression benutzt (Karpen, 1994), die Veranstaltung lief aber unter dem Titel „Vollspektrumbeleuchtung …“.
Behauptete Effekte der Vollspektrumbeleuchtung
Der Vater der Idee der Vollspektrumlampe, John N. Ott, hat eine Reihe von gesundheitlichen Schäden mittels künstlichen Beleuchtung mit Leuchtstofflampen in Verbindung gebracht. Er selbst war überzeugt, dass das bessere Licht seine Gesundheit förderte, und zog deswegen nach Sarasota, Florida. Seinen Glauben an die Wirkung hat er zum einen durch Experimente mit Pflanzenwachstum gefunden und zum anderen durch Erfahrungen von U-Bootbesatzungen, die nach der Einführung von nuklear angetriebenen Unterwasserschiffen Monate ohne Sonnenlicht verbringen mussten. Ott hat gezeigt, dass der Körper bei „falscher“ Beleuchtung nicht alle Nährstoffe optimal aufnehmen kann, wodurch nicht nur Ermüdung oder Depressionen entstehen können. Weitere Wirkungen, die Ott angeführt hat, reichen von Haarausfall bis Krebs.
In anderen Veröffentlichungen werden folgende Wirkungen angeführt (Gifford, 1994):
Physiologische Wirkungen
- Erhöhung der Sehschärfe
- Verminderung der Ermüdung
- Verminderung der Kariesgefahr
- Beschleunigung der Körperreife
- Verbesserung der Nervenfunktionen
Therapeutische Wirkungen
- Reduzierung der Winterdepression
- Reduzierung der Blumie
- Reduzierung des Hyperaktivität
Leistungsfähigkeit
- Erhöhung des Schulerfolgs
- Verbesserung der Teilnahme am Unterricht
- Verbesserung der Aufmerksamkeit
Befindlichkeit und Wahrnehmung
- Steigerung des Wohlbefindens
- Bessere Akzeptanz des Lichtspektrums
Kurz zusammengefasst:
- Vollspektrumlicht soll das Sehvermögen dramatisch steigern, das Lernverhalten von Schülern und den Lernerfolg verbessern.
- Der UV-Anteil der emittierten Strahlung soll in Arbeitsstätten die Wirkung ersetzen, die das Tageslicht im Freien ausüben würde. Hierzu ist zu bedenken, dass der Mensch in Industriegesellschaften bis zu 90% seines Lebens in geschlossenen Räumen verbringt, in die Tageslicht nicht, wenig oder spektral verändert eintritt.
- Vollspektrumlampen sollen bei der Therapie von Winterdepression erfolgreich sein (Maas, Jayson & Kleiber, 1974). Sie sollen sich positiv bei Hyperaktivitätsstörungen von Kindern auswirken.
Insgesamt werden ausschließlich positive Wirkungen behauptet, die von einer Verbesserung der Befindlichkeit bis hin zur Verhütung von Krebserkrankungen reichen.
Forschungsergebnisse
Güte der Simulation
Boyce hat an Hand der Spektralverteilungen von Tageslicht zu verschiedenen Phasen des Tages und der der „Vollspektrumlampen“ demonstriert, dass die Lampen allenfalls eine mäßige Simulation des natürlichen Lichts darstellen.
Dass sie in anderer Hinsicht mit dem Tageslicht überhaupt nicht mithalten können, müsste nicht extra hervorgehoben werden, gäbe es nicht so viele Menschen, die glauben, in ihrer künstlich beleuchteten Umgebung sei es zu hell. In Wirklichkeit erreicht man mit künstlicher Beleuchtung in Innenräumen nur einen Bruchteil der Lichtmenge, die z.B. an Fensterzonen von Räumen durch natürliches Licht einfällt. Und man weiß heute, dass für viele gesundheitlich relevante Effekte des Lichts die Lichtmenge bedeutsam ist, die das menschliche Auge und die Haut bzw. beide zusammen empfangen. Als „Lichtmenge“ ist dabei die Summe der sichtbaren Strahlung zu verstehen, die über einen bestimmten Zeitraum gemessen wird, die „Belichtung“. Dieser Begriff wurde früher nur in der Fotografie benutzt, weil die Wirkung auf den Film nicht durch eine momentane Größe (Beleuchtungsstärke) beschrieben wird, sondern durch dessen Zeitintegral (Belichtung in Luxsekunden)
Ein weiterer Faktor, bei dem Vollspektrumlampen das Tageslicht nicht gut simulieren können, ist die Veränderlichkeit. Insbesondere durch seine fortlaufende Veränderung in Menge und Qualität steuert das Tageslicht viele Körperfunktionen und trägt so der Gesundheit bei. Eine solche Wirkung kann bei künstlicher Beleuchtung nur künstlich herbei geführt werden. Ob man damit einen ähnlichen Effekt erzielen kann wie bei natürlichem Licht, ist nicht erwiesen. Erste Ansätze hierzu finden sich in neueren Arbeiten (Fleischer, 2001)
Wirkungen auf das Hormonsystem
Frühere Studien, mit denen man photobiologische Wirkungen des (künstlichen) Lichts, z.B. Wirkungen auf das Hormonsystem oder die Winterdepression, ermittelt hat, sind mit Vollspektrumlicht durchgeführt wurden. Es steht daher außer Frage, dass die Wirkung vorhanden ist.
Spätere Studien (z.B. Rosenthal & Blehar, 1989) haben aber gezeigt, dass man die gleichen Effekte auch mit anderen elektrischen Lichtquellen erreichen kann. Tatsächlich scheint die Lichtmenge die eigentlich wirksame Größe zu sein, allerdings unter der Bedingung, dass eine gewisse Mindestbeleuchtungsstärke am Auge überschritten wird.
Wirkungen des UV-Anteils
Die Befürworter der Vollspektrumlampe weisen darauf hin, dass in Innenräumen die lebenswichtige UV-Strahlung fehle. Dieses Argument ist zweifellos stichhaltig. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Photochemie nimmt man an, dass das Leben auf der Erde durch chemische Prozesse begonnen haben muss, die durch die UV-Strahlung in Gang gesetzt worden sind. Lebenswichtige Wirkungen der UV-Strahlung für den Menschen wie die Anregung der Vitamin D-Produktion sind seit langem bekannt.
Die Schwachstelle der Argumentation liegt allerdings bei der Frage der Intensität. Die lebenswichtige UV-Strahlung kann bei Überschreitung gewisser Grenzen der Bestrahlung auch eine tödliche Gefahr bedeuten. Auch dies weiß man nicht zuletzt aus der Photobiologie, nach deren Erkenntnissen das Leben zwar unter UV-Einwirkung begonnen haben muss, jedoch sofort vernichtet worden wäre, wenn sich die ersten Lebenskeime nicht hätten in größere Wassertiefen bewegen können, die Schutz vor UV-Strahlung boten. „Die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift sei“, sagte vor etwa fünfhundert Jahren Paracelsus. Das gleiche gilt auch für die UV-Strahlung, die sowohl Hautleiden verursachen als auch kurieren helfen kann.
Boyce bezweifelt, dass die von Vollspektrumlampen emittierte UV-Strahlung gegenüber der natürlichen überhaupt ins Gewicht fällt, ausgenommen im hohen Norden oder auf Forschungsstationen in der Antarktis. Veitch und McColl bezweifeln die Begründung von Ott und Cameron, dass der UV-Anteil von Vollspektrumlampen physiologisch wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden sei, weil der menschliche Organismus unter der Wirkung von UV-Strahlung entstanden wäre und sich in einer solchen Umgebung fortentwickelt hätte.
Verbesserung der Sehleistung
Vollspektrumlampen sollen eine bessere Sehleistung ermöglichen, indem sie einen höheren Anteil an kurzwelligem Licht emittieren. Die behauptete Wirkung wird zum einen darauf zurück geführt, dass auch bei hell adaptiertem Auge (Beleuchtungsniveau in Innenräumen) die Stäbchen (maximale Empfindlichkeit bei 508 nm) zur Hellempfindung beitrügen und nicht nur die Zapfen, deren maximale Empfindlichkeit im gelb-grünen Bereich liegt. Zum anderen aber wird behauptet, dass der Pupillendurchmesser durch einen höheren Anteil an kurzwelligem Licht kleiner würde und daher die Tiefenschärfe des Auges größer.
Beide Behauptungen werden durch mehrere Veröffentlichungen zumindest unterstützt (z.B. Berman, Fein, Jewett and Ashford 1994). Eine Diskussion der festgestellten Effekte findet sich in Veitch und McColl, 2001. Es existieren aber auch Veröffentlichungen, aus denen hervorgeht, dass die behaupteten Effekte nicht einträten. Ihnen ist häufig gemein, dass die Ergebnisse mit Leseversuchen ermittelt worden sind. Leseversuche, die mit alphabetischen Zeichen durchgeführt worden sind, sind aber nicht trennscharf, d.h., tatsächlich vorhandene Unterschiede von Testobjekten (in diesem Fall Lampentypen) werden nicht immer festgestellt. Daher gehen die methodischen Fehler der Untersuchung zu Lasten des Probanden.
Es ist möglich, dass bei Untersuchungen ein möglicher positiver Effekt von Vollspektrumlampen kleiner erscheint als vorhanden, weil diese Lampen eher farblich flimmern als andere, wenn sie mit üblichen Vorschaltgeräten betrieben werden. Da das Flimmern die Sehleistung herabsetzt, wird die Wirkung bei einem Versuch unterschätzt. Heute gibt es aber keinen vernünftigen Grund mehr, Leuchtstofflampen mit konventionellen Vorschaltgeräten zu betreiben.
Sehkomfort
Ob die Beleuchtung mit Vollspektrumlampen den Sehkomfort erhöht bzw. den sog. „discomfort“ mindert, ist umstritten. Das ist nicht verwunderlich, weil jeder Autor mangels eindeutiger Definition irgend etwas anderes als Sehkomfort untersucht hat, und zumal die lichttechnische Industrie dem Sehkomfort nicht mehr Bedeutung beimisst als einer Couch im Büro: „Das (gemeint sind Maßnahmen, die den Sehkomfort erhöhen und die Akzeptanz verbessern würden) kann ohne Frage Komfort und Akzeptanz der Beleuchtung erhöhen – ebenso wie dies eine Couch im Büro oder eine besonders komfortable Sitzgruppe tun würden.“ (aus der Broschüre Lichtforum 28 der Fördergemeinschaft Gutes Licht). Auch im CIE Technical Report „The Influence of Daylight and Artificial Light on Diurnal and Seasonal Variations in Humans. A Bibliography“ sucht man vergebens nach dem Begriff Sehkomfort, obwohl dieser Bericht ein verwandtes Thema behandelt. Das CIE Wörterbuch kennt ihn auch nicht.
Die Tatsache, dass die Wirkung von Vollspektrumlicht auf den Sehkomfort umstritten ist, darf aus den genannten Gründen nicht gegen sie bewertet werden. Deswegen werden die Befunde in der Literatur nicht diskutiert.
Wahrnehmung und Leistungsfähigkeit
Die Vollspektrumlampen mit ihrem relativ hohen Farbwiedergabeindex führen zu nachweisbaren Verbesserungen des Farberkennens. Es gibt aber auch andere Leuchtstofflampen, die eine gute Farbwiedergabe gewährleisten können.
Die Empfindung, dass Räume heller bzw. größer sind, kann durch diese Lampen unterstützt werden. Allerdings führen Veitch und McColl an, dass die Benutzer eher wärmere Lichtfarben bevorzugen.
Die Lernleistung von Schulkindern, häufig herangezogen, um Wirkungen der Beleuchtung zu ermitteln, scheint keine besondere Steigerung durch Vollspektrumlicht zu erfahren. Dies gilt vermutlich nur für Versuche, die man lediglich aus versuchstechnischen Gründen in Räumen ohne Tageslicht durchführt, bei denen man festgestellt hat, dass die Beleuchtung von Schulräumen keinen Einfluss auf die Lernleistung habe. Bei methodisch einwandfrei durchgeführten Untersuchungen, die allerdings in Schulen mit Fenstern und Oberlichtern stattfanden, konnte man einwandfrei einen signifikanten Einfluss der Beleuchtung auf den Lernerfolg von Schülern nachweisen (s. Daylighting in Schools, 2001). Zwei der möglichen Ursachen für die festgestellten positiven Wirkungen, bessere Farbwiedergabe und bessere Stimmung der Benutzer aufgrund der Lichtqualität, treffen auch für eine künstliche Beleuchtung mit Vollspektrumlampen Fzu.
Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von Erwachsenen sind keine Unterschiede zwischen Räumen mit unterschiedlicher Beleuchtung gefunden worden.
Schlussfolgerungen
Die behaupteten Wirkungen von Vollspektrumlicht konnten häufig nicht nachgewiesen werden. Die von Veitch und McColl geprüften Studien wiesen allerdings viele methodische Mängel auf, so dass man nicht den Schluss ziehen darf, dass die Wirkungen nicht vorhanden seien. Vielfach waren die Studien nicht geeignet, um bestimmte Effekte nachzuweisen.
Wer mit wissenschaftlichen Methoden nicht vertraut ist, wird ungern glauben, dass man solch triviale Dinge wie Ermüdung oder Lesbarkeit von Text nicht experimentell ermitteln kann, wo doch jeder Mensch weiß, was sie bedeuten. Es ist aber leider so. Um Sachverhalte wie die mentale Leistungsfähigkeit eines Erwachsenen oder den Lernerfolg von Schülern messbar zu machen, benötigt man sehr viel Aufwand. Für die oben zitierte Untersuchung „Daylighting in Schools“ mussten beispielsweise 50.000 Datensätze aus 102 Schulen erfasst, geprüft und ausgewertet werden. Wenn man z.B. aus wirtschaftlichen Gründen mit kleineren Stichproben arbeiten muss, wird man sehr häufig keine Unterschiede zwischen den erprobten Situationen (z.B. Beleuchtung mit verschiedenen Arten von Leuchtstofflampen) finden können, auch wenn sie vorhanden sind.
Das Vollspektrumlicht als Zankapfel zwischen Menschen, die an seine Wirkungen glauben, und anderen, die wissenschaftlich nachweisen wollen, ob und ggf. welche Wirkungen durch Lampen mit entsprechenden Eigenschaften bzw. durch Beleuchtung mit solchen Lampen erzeugt werden, wird uns noch geraume Zeit erhalten bleiben. Eine durchschlagende Wirkung hat die Vollspektrumlampe aber dennoch erzielt: Seit den ersten Erkenntnissen, die John Ott berichtet hatte, wird zunehmend stärker über die gesundheitlichen Wirkungen von Licht und Beleuchtung geforscht und gesprochen. Die medizinische Forschung hat hierbei u.a. das Licht bzw. eher den Mangel an Licht als die Ursache der seit mehr als 2.000 Jahren bekannten Winterdepression entlarvt.
Weiterführende Literatur und Links zum Thema
Dieser Beitrag enthält Bezüge zu folgenden Dokumenten, die über CyberLux abgerufen werden können. In diesen sind wiederum zahlreiche Literaturstellen angeführt, die sich für weiteres Studium eignen.
G. Cakir: Daylighting in Schools – Zusammenfassender Bericht über eine amerikanische Feldstudie, ERGONOMIC Institut, 2001
A.Cakir, G. Cakir: Tageslicht und Ergonomie, ERGONOMIC Institut, 2001
Joachim Fisch: Licht und Gesundheit – Das Leben mit optischer Strahlung, Technische Universität Ilmenau Fachgebiet Lichttechnik, März 2000
Veitch, J. A.; McColl, S. L.: A Critical examination of perceptual and cognitive effects attributed to full-spectrum fluorescent lighting, Ergonomics, v. 44, no. 3, Feb. 2001, pp. 255-279
Jennifer A. Veitch: Introduction: Full-Spectrum Lighting Effects on
Performance, Mood, and Health, IRC Internal Report No. 659, S. 4 ff., 1994
Daniel Karpen: Full-Spectrum Polarized Lighting: An Option for Light Therapy Boxes, IRC Internal Report No. 659, S. 6 ff, 1994
Peter R. Boyce: Is Full-Spectrum Lighting Special?, IRC Internal Report No. 659, S. 30 ff., 1994
Robert Gifford: Scientific Evidence for Claims about Full-Spectrum Lamps: Past and Future, IRC Internal Report No. 659, S. 37 ff, 1994
Anonymus: Panel Discussion from the Symposium „Full-Spectrum Fluorescent Lighting Effects on Performance, Mood, and Health“, IRC Internal Report No. 659, S. 47 ff., 1994
Jennifer A. Veitch: Conclusion: Is Full-Spectrum Light the Quality Choice?, IRC Internal Report No. 659, S. 112 ff., 1994
Folgender Bericht kann über die LiTG bzw. CIE beschafft werden. Er ist nicht über das Internet verfügbar:
THE INFLUENCE OF DAYLIGHT AND ARTIFICIAL LIGHT ON DIURNAL AND SEASONAL VARIATIONS IN HUMANS. A BIBLIOGRAPHY
ISBN 3 901 906 04 5, CIE 139 – 2001
Literatur
http://www.cwaller.de
http://international.mmm.com
Berman, S. M., Fein, G., Jewett, D. L., & Ashford, F. (1993): Luminance-controlled pupil size affects Landolt C task performance. Journal of the Illuminating Engineering Society, 22 , 150-165.
Fleischer, S.: Die psychologische Wirkung veränderlicher Kunstlichtsituationen auf den Menschen, Diss., 2001
MAAS, J. B., JAYSON, J. K. and KLEIBER, D. A., 1974, Effects of spectral differences in illumination on fatigue, Journal of Applied Psychology, 59, 524-526.
Rosenthal, N. E. & Blehar, M. C. (Eds.). (1989). Seasonal affective disorders and phototherapy. New York: Guildford Press.
eingestellt in CyberLux: 27. August 2001